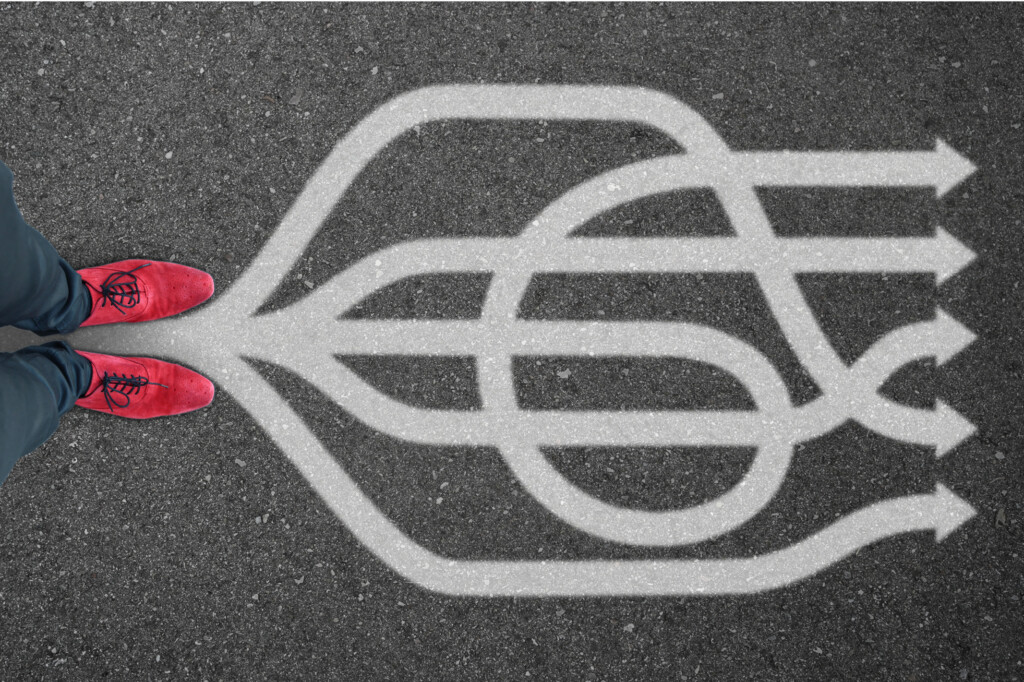
30 Jahre nach dem Examen — Eine weibliche juristische Biografie
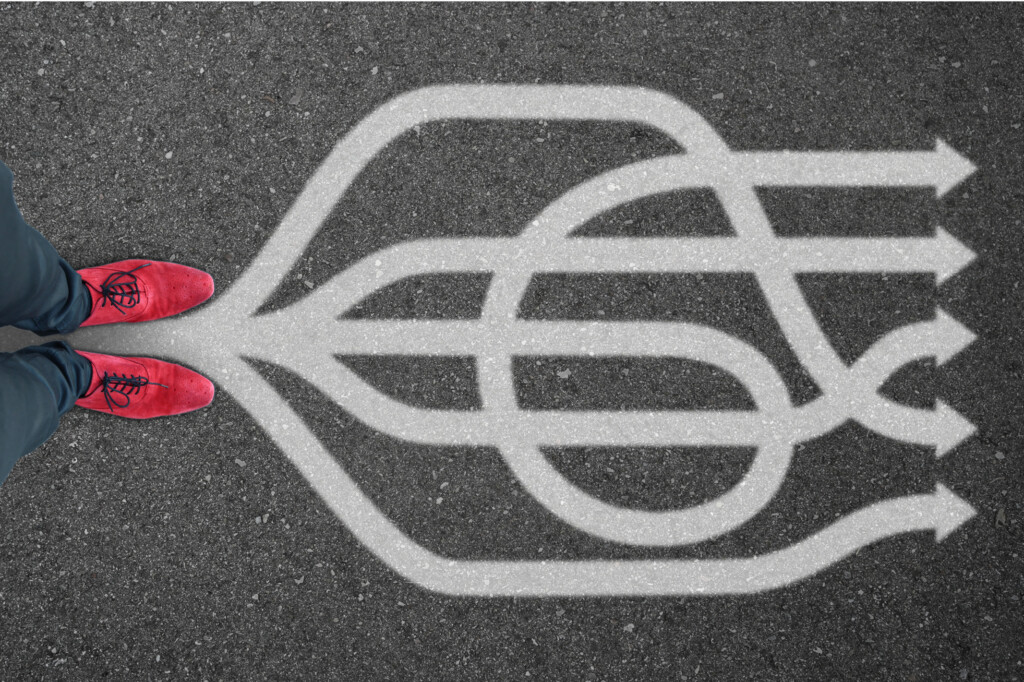
Viele Jahre vor meiner Zeit als Babyboomer-Nachwuchsjuristin gab es einen Gassenhauer von Curd Jürgens. Darin besang der Alt-Barde, er habe, „60 Jahre und kein bisschen weise (…) manchen Kratzer abgekriegt – zu sagen, es war halb so schlimm, das wär‘ gelogen.“ Er „habe längst nicht immer nur gesiegt, die Pose hat darüber weggetrogen“.
30 Jahre nach dem eigenen (Uni-)examen beginne ich zu ahnen, dass diese Zeilen weniger platt waren als damals gedacht: Biographien sind oft viel verschlungener, als man sich das anfangs so vorstellt, und zwar auch in beruflicher Hinsicht. Das gilt gerade dann, wenn man nicht die klassische Passform einer Richterin, eines Rechtsanwalts, einer Verwaltungs- oder Unternehmensjuristin hat. Trotzdem können juristische Biografien auch und gerade dann auf spannende Weise gelingen. (M)ein Beispiel.
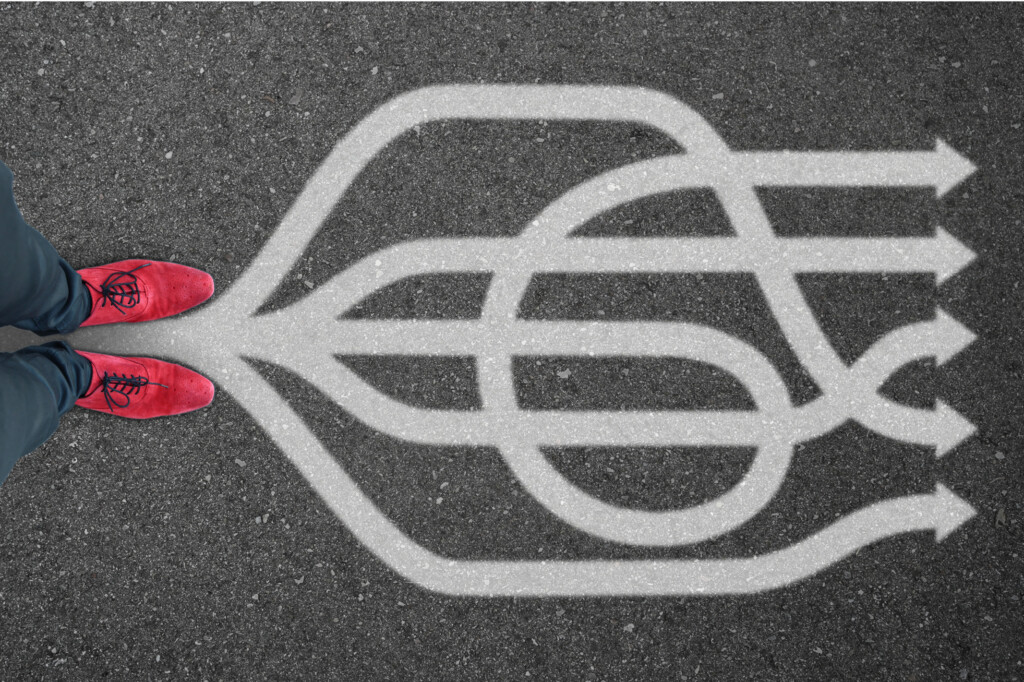
Biographien sind oft viel verschlungener, als man sich das anfangs so vorstellt, und zwar auch in beruflicher Hinsicht.
Ausgangspunkte: Idealismus, Sprachkompetenz
Nach meinem Abi vor 35 Jahren wollte ich die Welt retten. Für meine größte Waffe hielt ich dabei meine Sprachkompetenz – was also lag näher, als Journalistin zu werden? Das Internet war noch nicht erfunden, Blogs gab es noch keine, und die politischen Parteien standen mir seinerzeit alle nicht nahe genug, um mich dort zu engagieren. Die NGO, der mein Herzblut galt – amnesty international –, bot nur begrenzten Raum für ehrenamtliches Engagement (später hat Sohn Jonas dann im gleichen Alter sein FSJ in einem Flüchtlingscamp absolviert, worauf ich sehr stolz bin).
In dieser Situation bewarb ich mich als Zeitungspraktikantin bei der Frankfurter Rundschau. Mein sehr erfahrener Ausbilder riet indes von einem sofortigen Volontariat ab: „Studieren Sie lieber, dann sehen wir weiter!“. Mit einem Chemie-LK hätte es sich auch angeboten, Wissenschaftsjournalistin zu werden, also bewarb ich mich auf Studienplätze in Jura und Chemie. Den Jurastudienplatz habe ich behalten.
Ein interessantes Studium
Der erste Frust ließ nicht lange auf sich warten: Dass mich die Dogmatik allein nicht ausreichend mitreißen würde, wurde mir ziemlich schnell klar. Aber hier bot mir mein Studienort einen ganz besonderen Ausweg: Dank Adornos und Horkheimers rund um das Institut für Sozialforschung etablierter Frankfurter Schule gab es auch bei den Rechtswissenschaftlern eine besonders gute Infrastruktur im damaligen Schwerpunktbereich Rechtstheorie, Rechtssoziologie und Wissenschaftstheorie der Sozialwissenschaften.
Und ich hatte Glück: Gleich im 1. Semester stolperte ich mit Ulf Neumann über einen der besten akademischen Lehrer, die mir jemals begegnet sind. Bei ihm (und später an mehreren anderen Lehrstühlen) konnte ich sehr schnell Tutorin werden, engagierte mich außerdem im Fachbereichsrat und habe auf diesem Wege dafür gesorgt, dass die Sache spannend blieb.
Die Promotion
Weil mir der spätere Präsident unserer Universität, Rudolf Steinberg, nach dem Examen einen Assistentenplatz angeboten hatte, ging ich nicht ins Referendariat. Allerdings endete die angedachte Promotion im Asylrecht recht abrupt mit einem Zettel, den mir ein anderer Hochschullehrer unter der Tür durchschob. Er enthielt die Kopie eines der damals aufkommenden Drittstaatenurteile und den rot geschriebenen Satz: „Und in so einem Rechtsgebiet wollen Sie promovieren?“
Das war das Ende des Kapitels „Art 16 GG und ich“. Weil ich aus einer Ingenieursfamilie kam und ohnehin an einem öffentlich-rechtlichen Lehrstuhl arbeitete, schwenkte ich um auf Wirtschaftsverwaltungsrecht. Das zahlte sich aus, denn nach Auslandsaufenthalt und Fertigstellung bekam ich von einer großen internationalen Anwaltskanzlei den Preis für die beste wirtschaftsrechtliche Dissertation des Jahres: das ideale Eintrittsticket in die Welt der Advokatur. In der ich dann allerdings so niemals gelandet bin.

Jobmessen Jura
Karrieremessen von IQB & Myjobfair
Unsere Jobmessen & Karrieremessen für Juristen finden als Präsenzveranstaltung oder online statt und bieten Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteigern die ideale Orientierung in Sachen Karrierechancen.
Das Referendariat
Trotz meiner guten Noten hat mich der Referendardienst nämlich wieder daran erinnert, dass ich mich eigentlich nicht als „typische Juristin“ fühlte. Am besten waren noch das Auslandshalbjahr und die Zeit in einer Umweltschutzkanzlei – bis auf die Zeit vielleicht, in der ich für „meine“ Drittbetroffenen in einem weit entfernten Straßenbauamt nach Fehlern in einem Satz Planungsunterlagen suchte.
Bei der Akteneinsicht stellte sich heraus, dass die Planzeichnungen sämtlich die Unterschrift meines Vaters trugen. Den Fall habe ich dann nicht weiter bearbeitet. Aber mit den Stationen in Justiz und Verwaltung habe ich grundlegend gefremdelt, je länger, desto mehr.
In dieser Situation gab es zwei Möglichkeiten: Mich widerwillig anzupassen oder mein fachliches Engagement zu reduzieren und die Zeit anderweitig zu nutzen, auf die Gefahr hin, im zweiten Examen entsprechend schlechter abzuschneiden. Als Antwort auf die Frage, wie ich mich entschieden habe und ob das so richtig war, fällt mir ein anderer Song ein … der berühmte von Frank Sinatra.
Die Familienphase
Um mein zweites Staatsexamen herum passierte im Abstand weniger Wochen dreierlei: Ich verlor meinen Status als mehrfach stipendienverwöhnte Prädikatsjuristin, bekam mein zweites Kind und mein älteres Kind feierte seinen zweiten Geburtstag. Nun würde ich zwar erst recht nicht mehr zu einer juristischen Karriere durchstarten können, aber immerhin doch als Anwaltsgattin (auch der Vater der Kinder war mittlerweile mit der Ausbildung durch) und stolze SUV-Vorstadtmutti auf sonnendurchfluteten Kinderspielplätzen Fortbildung betreiben, bis die Reinemachefrau zu Hause ihr Tagewerk verrichtet hätte.
Aber Vorsicht, potenziell Betroffene beiderlei Geschlechts: Abseits der Werbung läuft das so dann nicht wirklich. Kinder haben ist anstrengend und Sie wären die erste Generation, bei der die Ansprüche nicht mit den Möglichkeiten mitwachsen würden. Von einer Entgrenzung Ihrer Arbeitszeiten und -orte im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung einmal ganz abgesehen.
In meinem persönlichen Fall stellte sich dann auch die Sinnfrage sehr schnell: Wozu war ich bis hierhergekommen – um mich jetzt an Regentagen in muffigen Turnhallen über die Qualität von Windeln auszutauschen? Und nur noch stolz auf andere Leute zu sein, egal ob sie 30 Monate oder 30 Jahre alt waren? In dieser Phase stieß mich der Vater meiner Kinder auf eine Stellenanzeige in der NJW: Schlussredakteur/in gesucht! Es gab also doch noch Gerechtigkeit auf der Welt, denn ich bekam den Job.
Die Redakteursstelle: (Fast) ein Traum
Vor über 20 Jahren gab es noch keine Redigaturprogramme im heutigen Sinne. Stattdessen würde von nun an, ich es sein, die all diese interessanten wissenschaftlichen Artikel sorgfältig lesen und dafür auch noch bezahlt werden würde. Ein Traum, zumal es sich um eine Teilzeitstelle handelte. 24 von 168 Stunden die Woche … kein Problem, fand ich. Eine zentrale Instanz war anderer Ansicht. Das war keineswegs die Familie: Meine Kinder blieben cool und freuten sich über zusätzliche Betreuungspersonen.
Allerdings streikte recht bald mein Körper. Er wehrte sich mit zwei Zusammenbrüchen allein innerhalb des ersten halben Jahres. Meinen damaligen Vorgesetzten habe ich vom Krankenhaus aus versichert, man könne mit der einen Hand auch schreiben, wenn die andere am Tropf hängt. Leider haben sie mir das durchweg geglaubt. Ob es richtig war, sich da durchzubeißen, wusste ich lange Zeit nicht. Zumal sich die Vorstellung vom Bezahltwerden fürs interessierte Lesen rasch als Traumtänzerei erwies: Wie alle Redakteure und Lektoren lernte ich mit großer Zuverlässigkeit, Fehler zu finden, ohne Inhalte groß zur Kenntnis zu nehmen. Korrekturlesen ist eine Kapazitätsfrage – ganz entfernt zu vergleichen mit dem Verkaufen in einer Bäckerei.
In beiden Fällen müssen Sie Ihre leckeren Teilchen auch ohne Verkosten an den Mann bringen können. Nach vier Jahren dann die Belohnung: Ich bekam mein eigenes juristisches Ressort. Passenderweise wurde mir die neu zu gründende Bau- und Vergaberechtszeitschrift des Verlags angetragen, die NZBau. Dieses Blatt habe ich dann sehr gerne und fast zehn Jahre lang geleitet, kombiniert mit entsprechenden Ressorts in NVwZ und NJW.
// Auch interessant: Vergaberecht in der Praxis
Keine Neuigkeit verpassen.
Newsletter abonnieren!
Pressesprecherin
Aber würde ich Redakteurin bis zur Rente bleiben wollen? Würde ich aus meiner Sprachkompetenz vielleicht noch mehr machen können, wenn ich Pressesprecherin in einer Anwaltskanzlei würde? Pressesprecherin einer der größten Anwaltskanzleien, diese Aussicht stand irgendwann zunehmend verlockend am Horizont. Ein privater Umstand kam hinzu: Mittlerweile war ich alleinerziehend, und solche Stellen waren – und sind – deutlich besser bezahlt als Redakteursstellen.
Allerdings haben sie in der Praxis, wie bald klar wurde, mit verbalem Brückenbau oder gar Sprachkunst nur sehr begrenzt zu tun. Pressesprecher(innen) sind im Alltag meist Lobbyisten, und oftmals sitzen sie zwischen sämtlichen Stühlen. Selbst wenn sie taktisch versiert und pragmatisch geschickt sind, für gestaltungswillige Naturen sind solche Positionen (anders als BD-Stellen) nicht gemacht.
Wieder Universität, …
Nach dieser so erhellenden wie ernüchternden zweieinhalbjährigen Erfahrung fiel mir wieder die Uni ins Auge. Hier hatte ich schon seit mehreren Jahren den Lehrauftrag für das Vergaberecht. In der Sache war der so wichtig wie ehrenvoll, geht es doch beim öffentlichen Einkauf um einen beträchtlichen Teil des EU-Haushalts. Allerdings wurden meine wöchentlichen Vorlesungen deshalb noch lange nicht vergütet. Ganz anders als das Projekt des juristischen An-Instituts ILF, das jetzt am dortigen House of Finance anstand: Für die dort engagierten Kanzleien sollten neue Formate entwickelt werden. Dieser hoch spannenden Aufgabe bin ich nachgekommen, während mich allmählich auch die Verlagsszene wieder in ihren Bann zog.
… und wieder Verlag
Mittlerweile waren meine Kinder größer, das nicht mehr ganz frisch gegründete Familienzentrum lief ebenso ohne mich wie ein zwischenzeitlich („Du bist doch Juristin!“) instandgesetzter Schulförderverein. Diese Konstellation bot Raum für einen Nebenjob: Im Nomos-Verlag gab es ein Nachschlagewerk mit einer Übersicht über die 700 wichtigsten Wirtschaftskanzleien, das Handbuch „Kanzleien in Deutschland“, dessen 25 Redakteure teilweise freiberuflich tätig waren. Schließlich konnte ich das Handbuch als Chefredakteurin übernehmen, gemeinsam mit der noch heute existierenden Zeitschrift „Karriere im Recht“. Indes galt auch jetzt: Nicht bis zur Rente – und nach dem Abitur meiner Kinder habe ich dann das gemacht, was im Grunde schon immer am besten zu mir gepasst hat, nämlich mich selbstständig.
Endlich: Der Sprung in die Selbstständigkeit
Mit Idealismus und Sprachkompetenz im Alter von 50 noch eine PR-Agentur zu gründen, wäre Jahre nach dem Siegeszug der elektronischen Medien allerdings ziemlich blödsinnig gewesen. Die Bereitschaft zum Zahlen für Printprodukte befand sich nach meiner und der Wahrnehmung vieler befreundeter Journalisten und Redakteure im freien Fall. Wer in einer der Schreibstuben einen festen (Alt-)vertrag hatte, hielt daran fest, und sei es zähneknirschend. Daneben war wenig Platz für auskömmliches Arbeiten, so wie ich es mittlerweile gewohnt war.
Aber es gab Alternativen: Wer sagte denn, dass Spezialisierungen immer primär an solchen Sachaspekten ausgerichtet sein mussten? Der Umstand, dass es offenbar alle anderen so machten, überzeugte mich nicht. Statt zur „PR für alle“ entschloss ich mich zur „Arbeit entlang der Wertschöpfungskette, aber speziell für Juristen (und artverwandte Berufe)“ – schließlich hatte ich in dieser Szene mittlerweile lange genug gelebt. Auch Anwaltsmandate hatte ich in den vergangenen zwei Jahrzehnten immer wieder einmal bearbeitet. Mit diesen Erwägungen im Hinterkopf habe ich dann verkürzt, aber griffiger formuliert, ein Büro für „Strategische Kanzleientwicklung“ gegründet. Das hat von Anfang an gut funktioniert, wenngleich natürlich auch hier „con lezioni“.

Stellenmarkt Jura
Lust auf neue Herausforderungen?
Spannende Jobs für Juristinnen und Juristen gibt es im Juraportal, unserer Stellenbörse für Jura Absolvent:innen und Studierende.
Weiterbildung zum Coach (IHK)
Dass wer sich selbstständig macht, etwas von Geld verstehen und Akquisequalitäten besitzen muss, ist fast eine Binsenweisheit. Auch dass man sich von der 40 (plus)-Stunden-in-5-Tagen-Woche recht weit entfernt, wird niemanden ernsthaft überraschen. Wichtig ist aber auch, dass Sie Ihre Geschäftspartner als Menschen richtig einschätzen können – ebenso wie sich selbst.
Als äußerst hilfreich hat sich in dieser Lage eine Coachingausbildung erwiesen. Auf dem Weg zum Business Coach haben meine Mitstreiter(innen) und ich systematisch gelernt, wie man mit einem Gegenüber konstruktiver umgehen kann. Auch außerhalb der einschlägigen Stunden möchte die entsprechenden Skills wirklich nicht missen.
Heute …
Rückblickend berate und schreibe ich viel und gerne. Mit Professor Schulz von der Heilbronner GGS (der übrigens seinen ersten Schein bei mir geschrieben hat), habe ich ein Großhandbuch zum „Recht 2030“ herausgegeben. Um zum Ausgangspunkt zurückzukehren, werde ich vermutlich auch dadurch die (Rechts-)Welt nicht retten können.
Trotzdem habe ich an guten Tagen den Eindruck, meine Umgebung ein Stück weit voranbringen, und das dann tatsächlich unter dem Einsatz meiner sprachlichen Fähigkeiten. Das war so nicht geplant, alles andere wäre ein Hindsight Bias oder Rückschau-Fehlschluss. Trotzdem hat es sich gut ergeben, und zwar, auch das ist wichtig, auch in wirtschaftlicher Hinsicht.
… braucht es noch immer Nehmerqualitäten (aber nicht nur)
Nehmerqualitäten gilt es gleichwohl zu besitzen, auch und gerade, wenn man freier Dienstleister ist. Juristen sind Statusmenschen, und Anwälte orientieren sich zuweilen an einer unsichtbaren Hierarchie, in der Richter, Journalisten und Mandanten über ihnen, sie selbst in der Mitte, Zuarbeiter aller Art aber darunter stehen und dann auch unter Stress so behandelt werden.
So erreichte mich unlängst auf meinen Hinweis auf einen Fernsehauftritt folgende Mail: „Ich bitte eindringlich darum, mich ab sofort von jeglichem Mailverteiler für Ihre Werbung zu entfernen. Ihre Mailings sind äußerst lästig (…). Freundliche Grüße Dr. NN (Großkanzlei).“ Das hat mich getroffen. Bis zum nächsten Tag: Bis dahin war ich nämlich zu dem Schluss gekommen, dass sich durchboxen auch durchaus einmal das alte Boxermotto beinhalten darf: „Lieber seine Mama heult als meine“. Der gute Mann war Counsel, und ich habe seine Mail als Bad Practice-Beispiel für Kommunikation an einen seiner Equity Partner weitergeleitet. Der hat dann mit seinem Kollegen ein klärendes Gespräch geführt und sich bei mir entschuldigt. Und weiter geht’s.
Ein Rat zum Schluss
Sollten auch Sie heute ohne die perfekte Passform, aber mit Idealismus und Sprachneigung Jura studieren, dann versuchen Sie es doch zur Abwechslung mal mit Reinhard Mey: „Es wär‘ so leicht, zu resignier’n statt nachzuseh‘n, statt zu probier‘n, ob da nicht doch noch Wege sind, wie man ein Stück Welt besser macht, um von den Schwätzern ausgelacht zu werden, als ein Narr, der spinnt. Ob ich‘s noch mal probier‘? Na klar! Mein guter alter Balthasar.“ Das hat er schon vor über 40 Jahren gesungen, und damit hat er ein riesiges Publikum erobert. Weil es nämlich im wirklichen Leben erstaunlich viele Leute gibt, die es ähnlich machen.
Weitere Themen
Juraportal
Spannende Jobs und Praktika findest du im Juraportal, dem Stellenmarkt für Juristinnen und Juristen
Stellenmarkt JuraKommende Jura Events
Fakultätskarrieretag Osnabrück – Jura & Wiwi
Fakultätskarrieretag Tübingen Jura
Fakultätskarrieretag Hamburg Jura
F.A.Z. Einspruch Podcast
Fakultätskarrieretag Hannover Jura
Alle Events anzeigen
Fakultätskarrieretag Mannheim 25. – 26. September 2024


Karriereziel Jura – Follow us on Instagram


Karrieremessen Jura
Unsere Jobmessen für Juristinnen und Juristen finden als Präsenzveranstaltung oder online statt.
Jobmessen für Juristen














